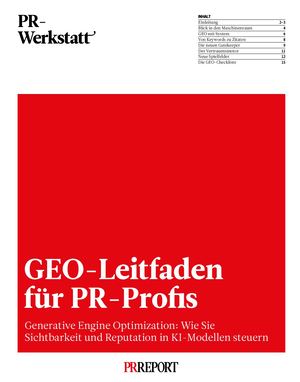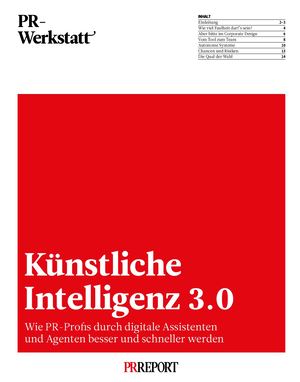News / „Ich stelle infrage, wie stark Unternehmen politische Akteure sein müssen“
06.08.2025
Wissen & Praxis
„Ich stelle infrage, wie stark Unternehmen politische Akteure sein müssen“
Der Wissenschaftler Olaf Hoffjann sieht einen Zusammenhang
zwischen Haltungskommunikation von Unternehmen und gesellschaftlicher Polarisierung. Und rät: Gutes tun und darüber schweigen.
Sie haben sich mit Haltungskommunikation oder – wie Sie es nennen – „Corporate Social Advocacy“ beschäftigt. „Medicine, Placebo or Poison?“ lautet der Titel Ihres Aufsatzes, der sich auf die Forschung zu dem Thema stützt. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen – ist Haltungskommunikation Medizin, Placebo oder Gift?
Olaf Hoffjann: Man muss zwei Ebenen unterscheiden: die der einzelnen Unternehmen und die der Gesellschaft. Für Unternehmen ist Corporate Social Advocacy nur in ganz wenigen Fällen Medizin, in der Regel ist es ein Placebo und häufiger Gift. Gesellschaftlich wirkt CSA stark als Gift, weil sie die Polarisierung verstärkt – und Unternehmen tragen mit zu dieser Verschärfung bei. Allerdings muss ich für die gesellschaftlichen Wirkungen einschränkend und selbstkritisch sagen: Das ist meine These, empirisch kann ich das nicht belegen. Ich kann mir jedoch auch kein Forschungsdesign vorstellen, mit dem man das belegen oder widerlegen könnte.
Was sagen die wissenschaftlichen Studien?
Wenn ein Unternehmen sehr homogene Zielgruppen hat, also Mitarbeitende und Kunden, die einhellig die Corporate-Social-Advocacy-Positionierung unterstützen, und wenn diese Positionierung zum bisherigen Image passt, kann CSA glaubwürdig und authentisch wirken und somit die Reputation stärken. Mitarbeiter machen sich in diesem Fall als Fürsprecher für ihren Arbeitgeber stark. Eine Studie zeigt auch positive Effekte auf Börsenkurse. Allerdings messen die vorliegenden Studien nur kurzfristige Wirkungen.
Was bedeutet das?
Sie messen nicht, ob und wie sich CSA langfristig auf Kaufhandlungen und Mitarbeitermotivation auswirkt. Hinzu kommt: Selbst Studien, die von positiven Effekten ausgehen, betonen, dass es auf die jeweilige Haltung der Zielgruppen ankommt. Je größer Unternehmen und je heterogener deren Stakeholder sind, desto wahrscheinlicher ist, dass CSA wie ein Gift wirkt. Kunden oder Mitarbeitende, die die politische Haltung eines Unternehmens ablehnen, könnten sich abwenden. Studien, die eher negative Effekte feststellen, schätzen die Risiken eines Boykotts höher ein als die Chance, zusätzliche Kunden zu gewinnen. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit eine höhere Identifikation der Mitarbeiter es aufwiegt, wenn auch nur wenige von ihnen, die eine gegenteilige politische Meinung haben, kündigen oder es zu Konflikten in der Belegschaft kommt. Selbst wenn eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten die politische Haltung ihres Arbeitgebers unterstützt, kann die starke negative Reaktion einer Minderheit enormen Schaden anrichten.
Worauf stützen Sie Ihre These, dass Haltungskommunikation nicht nur für Unternehmen giftig ist, sondern für die Gesellschaft insgesamt?
Ich habe mir unter anderem angeschaut, wie sich in den USA klassische CSA-Themen entwickelt haben. Dazu gehören Immigration und Waffenkontrolle. Die Zahlen zeigen, dass diese Themen keinesfalls gelöst sind und die Polarisierung dazu nicht schwächer wird: Weder setzt sich eine Seite in der Debatte durch noch gleichen sich die Positionen an. Im Gegenteil.
Und dafür sollen wirklich Unternehmen mitverantwortlich sein?
Mir ist klar, dass es für gesellschaftliche Polarisierungsprozesse sehr viel wichtigere Faktoren gibt als Kampagnen von Unternehmen oder Statements von deren CEOs. Aber Unternehmen – so meine These – tragen zumindest mit dazu bei, dass sich die Spirale der Polarisierung immer weiter dreht und die Gräben zwischen gesellschaftlichen Gruppen vertiefen. Wenn Unternehmen sich politisch positionieren, ordnen sie sich mit ihren Stakeholdern, die die Haltung unterstützen, einer Seite des Grabens zu. Zudem gehen Gesprächsräume verloren.
Was meinen Sie damit?
Wir alle bewegen uns in verschiedenen sozialen Sphären und nehmen dabei jeweils unterschiedliche Rollen ein. Gegner oder Konkurrenten in einer Sphäre, zum Beispiel Republikaner und Demokraten in der Politik, stehen in einer anderen Sphäre, zum Beispiel in einer Religionsgemeinschaft, auf der gleichen Seite. Wenn immer mehr dieser Sphären politisiert werden, vertieft das die gesellschaftliche Spaltung, weil politische Konfliktlinien zunehmend unpolitische Rollen prägen.
Auch Unternehmen bilden solche Sphären und Gesprächsräume?
Genau. Es gab früher eine Art Business-Knigge: Bei der Arbeit spricht man nicht über Politik, Religion und Geld. Unverfänglicher Smalltalk über Fußball, das Wetter und Urlaub hat einen Nutzen: Er verbindet, schafft Verständnis füreinander, auch wenn man ahnt, dass das Gegenüber eine andere politische Einstellung hat. Das depolarisiert. Aber diese Gesprächsräume gehen verloren, wenn Unternehmen sich öffentlich politisch positionieren. Sie sorgen mit dafür, dass Politik ins Unternehmen getragen, dass womöglich intern über Themen wie Gendern, Klima und Krieg gestritten wird. Das führt zu Gräben und Mauern in der Belegschaft und verstärkt die Gräben und Mauern in der gesamten Gesellschaft.
Um das noch mal klarzumachen: Ihre These ist, dass Unternehmen zu einer Verschärfung gesellschaftlicher Polarisierung beitragen, wenn sie sich beispielsweise für Minderheiten und gegen Diskriminierung und Gewalt starkmachen?
Das ist mir total wichtig: Natürlich sollen sich Unternehmen beispielsweise für Minderheiten einsetzen und Diskriminierung strikt ahnden. Im Zweifel sogar noch stärker als bisher. Die Frage ist aber: Wie stark sollten sie das nach außen tragen und öffentlich darüber reden.
Wenn über bestimmte Themen nicht mehr gesprochen wird, könnten sie aus dem Bewusstsein verschwinden und an Bedeutung verlieren.
Diese Gefahr besteht natürlich. In der Kommunikationswissenschaft gibt es das Konzept des „Aspirational Talk“: Wer öffentlich ambitionierte Ziele ausgibt, setzt sich damit selbst unter Druck, diese Ziele zu erreichen. Aber letztlich geht es darum, wie Unternehmen handeln. Und deshalb stelle ich infrage, wie stark Unternehmen politische Akteure sein müssen und ob es hilft, wenn sie sich zu einer Vielzahl von politischen Themen zu Wort melden.
PR-Chefs würden antworten, dass Stakeholder es von Unternehmen einfordern, zu bestimmten Themen Position zu beziehen oder sich zumindest zu Wort melden.
Diese Zwänge gibt es, keine Frage. Allerdings haben Unternehmen teilweise selbst dazu beigetragen.
Wie meinen Sie das?
Über Corporate Social Responsibility positionieren sie sich seit Jahrzehnten als gesellschaftlicher Akteur und nun seit einigen Jahren über Corporate Social Advocacy auch als gesellschaftspolitischer Akteur. Letzteres ist eine Reaktion auf die zunehmende Polarisierung westlicher Gesellschaften. Unternehmen haben das in ihrer Kommunikation aufgenommen. Eine Annahme dahinter ist, dass die politischen Einstellungen von Konsumenten deren Kaufentscheidungen beeinflussen. Eine weitere ist, dass Unternehmen so ihre Licence to operate sichern können. Die Folge war eine Institutionalisierung von CSA: Durch die Vorreiter gerieten andere Unternehmen unter Druck, sich ebenfalls zu positionieren. Und wenn sich Unternehmen zum Beispiel für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen haben, weckten sie damit die Erwartung, auch für andere Minderheiten einzustehen. Die moralische Latte für alle Unternehmen wurde immer höher gelegt. Und nun leiden alle Unternehmen unter der weiter zunehmenden Polarisierung, die in den USA besonders stark ist.
Was ist der Unterschied zwischen CSR und CSA?
CSA definiere ich als die kommunikativen Maßnahmen von Unternehmen im Kontext umstrittener gesellschaftspolitischer Themen, ohne direkten Bezug zu deren Geschäftstätigkeit. Wirtschaftliche Relevanz kann sie dennoch indirekt haben: Wenn sich Unternehmen zum Beispiel gegen Diskriminierung zu Wort melden, beeinflusst das Wahrnehmung und Haltung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei CSR geht es um Maßnahmen von Unternehmen, mit denen sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden möchten. CSR-Themen haben in der Regel einen direkten Bezug zur Geschäftstätigkeit, sind aber wenig polarisierend.
Folgt man Ihrer These, dann haben Unternehmen zu einem Backlash und womöglich zur Wiederwahl von Donald Trump beigetragen.
Ja, weil sie zur Lagerbildung beitragen. In den USA viel ausgeprägter als hierzulande. Das Problem ist, dass beispielsweise Diversitäts-Programme dort zu einem Symbol für linke, progressive Politik geworden sind. In Deutschland ist dasselbe mit der gendergerechten Sprache passiert. Zu beiden Themen werden Kulturkämpfe ausgefochten. Und Unternehmen haben diese Kulturkämpfe mit ihren gut gemeinten öffentlichen Positionierungen zusätzlich angefacht. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen beispielsweise den Rechten und dem Schutz von Minderheiten viel besser gedient hätten, wenn sie sich intern für sie stark gemacht, es aber nach außen nicht kommuniziert hätten. Um das noch mal zu betonen: Die allermeisten Unternehmen haben mit bester Absicht gehandelt. Und ich habe größten Respekt davor, dass sie das trotz absehbarer Kritik und Kündigungen gemacht haben. Ich bezweifle indes, dass das ihren guten Anliegen geholfen hat.
Wie schätzen Sie die Situation in Deutschland ein?
Wir sind von einer Polarisierung wie in den USA weit entfernt. Gott sei Dank. Aber sie schreitet voran. Denken Sie an Corona: Das Thema Impfung hat einen Keil in die Gesellschaft geschlagen und damit auch in die Unternehmen.
In den vergangenen Jahren gab es diverse Aktionen und Wortmeldungen von Unternehmen, die sich direkt oder indirekt gegen die AfD richteten. Hat das alles nichts gebracht oder noch mehr Stimmen für die Partei verhindert?
Ich glaube nicht, dass es mehr Stimmen für die AfD verhindert hat. Wenn wir AfD-Wählerinnen und -Wähler für demokratische Parteien zurückgewinnen möchten, müssen wir mit ihnen im Gespräch bleiben. Deshalb müssen die Gesprächsräume offen bleiben, auch die in den Unternehmen.
Was raten Sie Unternehmen?
Unternehmen sollten zunächst vager, ambivalenter, zurückhaltender, konsensorientierter kommunizieren, um irgendwann gar nicht mehr über Politik zu reden.
Geht das heutzutage überhaupt?
Unternehmen, die sich zuletzt politisch positioniert haben, können nicht von heute auf morgen plötzlich schweigen. Ich sehe das eher als Abkühlungsprozess. Sie sollten sich öffentlich defensiver verhalten, aber intern weiterhin oder noch entschlossener beispielsweise gegen Diskriminierung vorgehen. Gutes tun und darüber schweigen, liegt aus meiner Sicht nicht nur im Eigeninteresse der Unternehmen, sondern der Gesellschaft insgesamt.
Olaf Hoffjann ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Interview: Daniel Neuen
Exklusive und aktuelle Nachrichten aus der Kommunikationsszene gibt es jeden Mittwoch und Freitag in unserem Newsletter. Kostenlos abonnieren unter http://www.prreport.de/newsletter/
Olaf Hoffjann: Man muss zwei Ebenen unterscheiden: die der einzelnen Unternehmen und die der Gesellschaft. Für Unternehmen ist Corporate Social Advocacy nur in ganz wenigen Fällen Medizin, in der Regel ist es ein Placebo und häufiger Gift. Gesellschaftlich wirkt CSA stark als Gift, weil sie die Polarisierung verstärkt – und Unternehmen tragen mit zu dieser Verschärfung bei. Allerdings muss ich für die gesellschaftlichen Wirkungen einschränkend und selbstkritisch sagen: Das ist meine These, empirisch kann ich das nicht belegen. Ich kann mir jedoch auch kein Forschungsdesign vorstellen, mit dem man das belegen oder widerlegen könnte.
Was sagen die wissenschaftlichen Studien?
Wenn ein Unternehmen sehr homogene Zielgruppen hat, also Mitarbeitende und Kunden, die einhellig die Corporate-Social-Advocacy-Positionierung unterstützen, und wenn diese Positionierung zum bisherigen Image passt, kann CSA glaubwürdig und authentisch wirken und somit die Reputation stärken. Mitarbeiter machen sich in diesem Fall als Fürsprecher für ihren Arbeitgeber stark. Eine Studie zeigt auch positive Effekte auf Börsenkurse. Allerdings messen die vorliegenden Studien nur kurzfristige Wirkungen.
Was bedeutet das?
Sie messen nicht, ob und wie sich CSA langfristig auf Kaufhandlungen und Mitarbeitermotivation auswirkt. Hinzu kommt: Selbst Studien, die von positiven Effekten ausgehen, betonen, dass es auf die jeweilige Haltung der Zielgruppen ankommt. Je größer Unternehmen und je heterogener deren Stakeholder sind, desto wahrscheinlicher ist, dass CSA wie ein Gift wirkt. Kunden oder Mitarbeitende, die die politische Haltung eines Unternehmens ablehnen, könnten sich abwenden. Studien, die eher negative Effekte feststellen, schätzen die Risiken eines Boykotts höher ein als die Chance, zusätzliche Kunden zu gewinnen. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit eine höhere Identifikation der Mitarbeiter es aufwiegt, wenn auch nur wenige von ihnen, die eine gegenteilige politische Meinung haben, kündigen oder es zu Konflikten in der Belegschaft kommt. Selbst wenn eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten die politische Haltung ihres Arbeitgebers unterstützt, kann die starke negative Reaktion einer Minderheit enormen Schaden anrichten.
Worauf stützen Sie Ihre These, dass Haltungskommunikation nicht nur für Unternehmen giftig ist, sondern für die Gesellschaft insgesamt?
Ich habe mir unter anderem angeschaut, wie sich in den USA klassische CSA-Themen entwickelt haben. Dazu gehören Immigration und Waffenkontrolle. Die Zahlen zeigen, dass diese Themen keinesfalls gelöst sind und die Polarisierung dazu nicht schwächer wird: Weder setzt sich eine Seite in der Debatte durch noch gleichen sich die Positionen an. Im Gegenteil.
Und dafür sollen wirklich Unternehmen mitverantwortlich sein?
Mir ist klar, dass es für gesellschaftliche Polarisierungsprozesse sehr viel wichtigere Faktoren gibt als Kampagnen von Unternehmen oder Statements von deren CEOs. Aber Unternehmen – so meine These – tragen zumindest mit dazu bei, dass sich die Spirale der Polarisierung immer weiter dreht und die Gräben zwischen gesellschaftlichen Gruppen vertiefen. Wenn Unternehmen sich politisch positionieren, ordnen sie sich mit ihren Stakeholdern, die die Haltung unterstützen, einer Seite des Grabens zu. Zudem gehen Gesprächsräume verloren.
Was meinen Sie damit?
Wir alle bewegen uns in verschiedenen sozialen Sphären und nehmen dabei jeweils unterschiedliche Rollen ein. Gegner oder Konkurrenten in einer Sphäre, zum Beispiel Republikaner und Demokraten in der Politik, stehen in einer anderen Sphäre, zum Beispiel in einer Religionsgemeinschaft, auf der gleichen Seite. Wenn immer mehr dieser Sphären politisiert werden, vertieft das die gesellschaftliche Spaltung, weil politische Konfliktlinien zunehmend unpolitische Rollen prägen.
Auch Unternehmen bilden solche Sphären und Gesprächsräume?
Genau. Es gab früher eine Art Business-Knigge: Bei der Arbeit spricht man nicht über Politik, Religion und Geld. Unverfänglicher Smalltalk über Fußball, das Wetter und Urlaub hat einen Nutzen: Er verbindet, schafft Verständnis füreinander, auch wenn man ahnt, dass das Gegenüber eine andere politische Einstellung hat. Das depolarisiert. Aber diese Gesprächsräume gehen verloren, wenn Unternehmen sich öffentlich politisch positionieren. Sie sorgen mit dafür, dass Politik ins Unternehmen getragen, dass womöglich intern über Themen wie Gendern, Klima und Krieg gestritten wird. Das führt zu Gräben und Mauern in der Belegschaft und verstärkt die Gräben und Mauern in der gesamten Gesellschaft.
Um das noch mal klarzumachen: Ihre These ist, dass Unternehmen zu einer Verschärfung gesellschaftlicher Polarisierung beitragen, wenn sie sich beispielsweise für Minderheiten und gegen Diskriminierung und Gewalt starkmachen?
Das ist mir total wichtig: Natürlich sollen sich Unternehmen beispielsweise für Minderheiten einsetzen und Diskriminierung strikt ahnden. Im Zweifel sogar noch stärker als bisher. Die Frage ist aber: Wie stark sollten sie das nach außen tragen und öffentlich darüber reden.
Wenn über bestimmte Themen nicht mehr gesprochen wird, könnten sie aus dem Bewusstsein verschwinden und an Bedeutung verlieren.
Diese Gefahr besteht natürlich. In der Kommunikationswissenschaft gibt es das Konzept des „Aspirational Talk“: Wer öffentlich ambitionierte Ziele ausgibt, setzt sich damit selbst unter Druck, diese Ziele zu erreichen. Aber letztlich geht es darum, wie Unternehmen handeln. Und deshalb stelle ich infrage, wie stark Unternehmen politische Akteure sein müssen und ob es hilft, wenn sie sich zu einer Vielzahl von politischen Themen zu Wort melden.
PR-Chefs würden antworten, dass Stakeholder es von Unternehmen einfordern, zu bestimmten Themen Position zu beziehen oder sich zumindest zu Wort melden.
Diese Zwänge gibt es, keine Frage. Allerdings haben Unternehmen teilweise selbst dazu beigetragen.
Wie meinen Sie das?
Über Corporate Social Responsibility positionieren sie sich seit Jahrzehnten als gesellschaftlicher Akteur und nun seit einigen Jahren über Corporate Social Advocacy auch als gesellschaftspolitischer Akteur. Letzteres ist eine Reaktion auf die zunehmende Polarisierung westlicher Gesellschaften. Unternehmen haben das in ihrer Kommunikation aufgenommen. Eine Annahme dahinter ist, dass die politischen Einstellungen von Konsumenten deren Kaufentscheidungen beeinflussen. Eine weitere ist, dass Unternehmen so ihre Licence to operate sichern können. Die Folge war eine Institutionalisierung von CSA: Durch die Vorreiter gerieten andere Unternehmen unter Druck, sich ebenfalls zu positionieren. Und wenn sich Unternehmen zum Beispiel für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen haben, weckten sie damit die Erwartung, auch für andere Minderheiten einzustehen. Die moralische Latte für alle Unternehmen wurde immer höher gelegt. Und nun leiden alle Unternehmen unter der weiter zunehmenden Polarisierung, die in den USA besonders stark ist.
Was ist der Unterschied zwischen CSR und CSA?
CSA definiere ich als die kommunikativen Maßnahmen von Unternehmen im Kontext umstrittener gesellschaftspolitischer Themen, ohne direkten Bezug zu deren Geschäftstätigkeit. Wirtschaftliche Relevanz kann sie dennoch indirekt haben: Wenn sich Unternehmen zum Beispiel gegen Diskriminierung zu Wort melden, beeinflusst das Wahrnehmung und Haltung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei CSR geht es um Maßnahmen von Unternehmen, mit denen sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden möchten. CSR-Themen haben in der Regel einen direkten Bezug zur Geschäftstätigkeit, sind aber wenig polarisierend.
Folgt man Ihrer These, dann haben Unternehmen zu einem Backlash und womöglich zur Wiederwahl von Donald Trump beigetragen.
Ja, weil sie zur Lagerbildung beitragen. In den USA viel ausgeprägter als hierzulande. Das Problem ist, dass beispielsweise Diversitäts-Programme dort zu einem Symbol für linke, progressive Politik geworden sind. In Deutschland ist dasselbe mit der gendergerechten Sprache passiert. Zu beiden Themen werden Kulturkämpfe ausgefochten. Und Unternehmen haben diese Kulturkämpfe mit ihren gut gemeinten öffentlichen Positionierungen zusätzlich angefacht. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen beispielsweise den Rechten und dem Schutz von Minderheiten viel besser gedient hätten, wenn sie sich intern für sie stark gemacht, es aber nach außen nicht kommuniziert hätten. Um das noch mal zu betonen: Die allermeisten Unternehmen haben mit bester Absicht gehandelt. Und ich habe größten Respekt davor, dass sie das trotz absehbarer Kritik und Kündigungen gemacht haben. Ich bezweifle indes, dass das ihren guten Anliegen geholfen hat.
Wie schätzen Sie die Situation in Deutschland ein?
Wir sind von einer Polarisierung wie in den USA weit entfernt. Gott sei Dank. Aber sie schreitet voran. Denken Sie an Corona: Das Thema Impfung hat einen Keil in die Gesellschaft geschlagen und damit auch in die Unternehmen.
In den vergangenen Jahren gab es diverse Aktionen und Wortmeldungen von Unternehmen, die sich direkt oder indirekt gegen die AfD richteten. Hat das alles nichts gebracht oder noch mehr Stimmen für die Partei verhindert?
Ich glaube nicht, dass es mehr Stimmen für die AfD verhindert hat. Wenn wir AfD-Wählerinnen und -Wähler für demokratische Parteien zurückgewinnen möchten, müssen wir mit ihnen im Gespräch bleiben. Deshalb müssen die Gesprächsräume offen bleiben, auch die in den Unternehmen.
Was raten Sie Unternehmen?
Unternehmen sollten zunächst vager, ambivalenter, zurückhaltender, konsensorientierter kommunizieren, um irgendwann gar nicht mehr über Politik zu reden.
Geht das heutzutage überhaupt?
Unternehmen, die sich zuletzt politisch positioniert haben, können nicht von heute auf morgen plötzlich schweigen. Ich sehe das eher als Abkühlungsprozess. Sie sollten sich öffentlich defensiver verhalten, aber intern weiterhin oder noch entschlossener beispielsweise gegen Diskriminierung vorgehen. Gutes tun und darüber schweigen, liegt aus meiner Sicht nicht nur im Eigeninteresse der Unternehmen, sondern der Gesellschaft insgesamt.
Olaf Hoffjann ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Interview: Daniel Neuen
Exklusive und aktuelle Nachrichten aus der Kommunikationsszene gibt es jeden Mittwoch und Freitag in unserem Newsletter. Kostenlos abonnieren unter http://www.prreport.de/newsletter/
Weitere Themen
16.12.2025
29.01.2026
05.12.2025