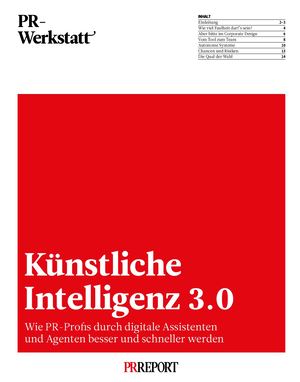News / Wer heute laviert, darf sich morgen nicht wundern
04.06.2025
Kolumne
Wer heute laviert, darf sich morgen nicht wundern
Trump kämpft gegen Diversity – und viele Unternehmen knicken ein. Ein fatales Signal, schreibt Cornelia Kunze in ihrem Gastkommentar.
Lange haben wir in Politik, Wirtschaft und Kommunikation daran gearbeitet, dass Führungsteams vielfältiger werden. Nicht aus Imagegründen. So denke ich. Sondern weil sich eine Erkenntnis durchgesetzt hatte – mithilfe von Studien, Erfahrungswerten, messbarem Fortschritt: Vielfalt macht Unternehmen besser. Sie werden innovativer, erfolgreicher, resilienter, wenn Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Identität oder religiöser Überzeugung gleiche Chancen haben.
Doch diese Fortschritte waren kein Selbstläufer. Sie wurden hart erkämpft. Die Veränderung kam nicht nur „von innen heraus“, weil Unternehmen schon immer so dachten oder der „Purpose“ sie dazu trieb. Sie wurde durch gesellschaftlichen Wandel, durch Debatten, durch Gesetze angestoßen. Und durch Quoten.
Eine neue Realität
Auch wir Kommunikationsprofis haben daran mitgewirkt. Wir haben Diversity-Programme gestaltet, kommuniziert, Vorstandsstimmen gestärkt, Initiativen strategisch durchdacht und sichtbar gemacht. Wir haben interne Townhalls begleitet, Studien publiziert und uns an Benchmarkings beteiligt. Wir haben CSR-Reports erstellt und gefeiert, in denen erstmals Bonusregelungen an die Erreichung von Frauenquoten geknüpft wurden. Wir haben PR-Fotos von neu und vielfältig besetzten Aufsichtsräten verschickt, stolz unsere internen Fortschritte geteilt.
Und unsere Unternehmen und Agenturen haben Aufmerksamkeit und Anerkennung von Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern dankend angenommen. In Agenturen haben wir erlebt, wie internationale Großkunden fragten: Wie divers seid Ihr aufgestellt? Und wenn wir diese Fragen nicht überzeugend beantworten konnten, bekamen wir den Auftrag nicht. Das war Realität. Eine, die zunächst schwierig war, die wir aber als Fortschritt empfanden.
Vorauseilender Gehorsam
Es fühlte sich an, als sei der Weg klar: Es ging aufwärts. DEI war nicht mehr „nice to have“, sondern Standard. Und nun? Nun kippt etwas. Mindestens das Vertrauen.
Nach und nach rudern Unternehmen zurück, stellen Maßnahmen ein, verringern Visibilität und Transparenz und versprechen, dass natürlich trotzdem alles „haltungsmäßig“ beim Alten bleibt. Als ob diese Maßnahmen keinen wesentlichen Unterschied gemacht hätten. Auch außerhalb der USA – wo selbstverständlich die Gesetze eingehalten werden müssen – scheinen bei Missachtung der neuen Ansagen der Trump-Regierung wirtschaftliche Nachteile im Raum und Arbeitsplätze auf dem Spiel zu stehen. Ein nicht zu unterschätzender Zielkonflikt.
Worauf es hinausläuft: Ein mitunter vorauseilender Gehorsam trifft uns in Europa. Unternehmen, die fest zu DEI standen, streichen interne Quoten, ordnen DEI-Abteilungen neu, ändern Narrative, passen Reports und Vorstands-Statements an. Sie reagieren auf politischen Druck eines Landes, in dem Anti-Diversity-Strömungen salonfähig geworden sind. Einige schneller, aus Angst, der Wind könnte sich weiter drehen oder weil ihr wirtschaftlicher Erfolg entscheidend vom US-Markt abhängt. Andere schweigen, warten – und hoffen, dass niemand etwas merkt.
Können wir uns das leisten?
Dabei ist das Signal fatal: Wer Haltung einkassiert, sobald sie unbequem wird, hatte nie eine. Wenn das alles nie so wichtig war, warum listeten dann Führungskräfte zu jedem Feiertag der Vielfalt auf Linkedin ihre Errungenschaften auf? Es geht nicht um Symbolpolitik. Es geht um echte Fortschritte – und um die Frage, ob wir es uns leisten können, sie aufs Spiel zu setzen.
Wenn Quoten fallen, wenn Bonusregelungen gestrichen werden, Verantwortlichen für das Thema DEI die Budgets entzogen werden, Vorstandsetagen wieder verstummen, dann wird das Konsequenzen haben. Wir werden verlieren: an inklusiver Teilhabe, vielfältiger Zusammensetzung von Teams, transparenter leistungsorientierter Rekrutierung, Förderung und Beförderung. Es kann auch bedeuten, dass alte Rekrutierungs- und Fördermechanismen wieder greifen – jene, die Jahrzehnte lang für Exklusion gesorgt haben.
Es war ein Versprechen
Die, die nie etwas von Vielfalt hielten, sagen nun: Endlich hört der „Blödsinn“ auf. Aber für uns andere stellt sich weiterhin die Frage: Wie bleiben wir dran und wie weisen wir das nach? Was sagen wir unseren Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden, denen unser Management jahrelang vermittelt hat: Vertraut uns – auch wegen unserer Haltung? Was sagen wir jenen, die uns genau deshalb gewählt haben – als Arbeitgeber, als Marke, als Partner? Was bleibt vom Employer Branding, wenn das, wofür wir angeblich stehen, beim ersten – zugegebenermaßen starken – Gegenwind zurückgenommen wird?
Vertrauen entsteht durch Haltung und durch Beständigkeit. Wer heute laviert, darf sich morgen nicht wundern, wenn Talente sich abwenden und Loyalität erodiert. Denn für viele – intern wie extern – war das nicht „nur ein Programm“. Es war ein Versprechen. Und jetzt schauen alle sehr genau hin, ob wir es halten.
Autorin: Cornelia Kunze ist 1. Vorsitzende von Global Women in Public Relations (GWPR) Deutschland und Inhaberin von I-sekai. Dieser Gast-Beitrag stammt aus dem neuen PR Report.
Exklusive und aktuelle Nachrichten aus der Kommunikationsszene gibt es jeden Mittwoch und Freitag in unserem Newsletter. Kostenlos abonnieren unter http://www.prreport.de/newsletter/
Doch diese Fortschritte waren kein Selbstläufer. Sie wurden hart erkämpft. Die Veränderung kam nicht nur „von innen heraus“, weil Unternehmen schon immer so dachten oder der „Purpose“ sie dazu trieb. Sie wurde durch gesellschaftlichen Wandel, durch Debatten, durch Gesetze angestoßen. Und durch Quoten.
Eine neue Realität
Auch wir Kommunikationsprofis haben daran mitgewirkt. Wir haben Diversity-Programme gestaltet, kommuniziert, Vorstandsstimmen gestärkt, Initiativen strategisch durchdacht und sichtbar gemacht. Wir haben interne Townhalls begleitet, Studien publiziert und uns an Benchmarkings beteiligt. Wir haben CSR-Reports erstellt und gefeiert, in denen erstmals Bonusregelungen an die Erreichung von Frauenquoten geknüpft wurden. Wir haben PR-Fotos von neu und vielfältig besetzten Aufsichtsräten verschickt, stolz unsere internen Fortschritte geteilt.
Und unsere Unternehmen und Agenturen haben Aufmerksamkeit und Anerkennung von Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern dankend angenommen. In Agenturen haben wir erlebt, wie internationale Großkunden fragten: Wie divers seid Ihr aufgestellt? Und wenn wir diese Fragen nicht überzeugend beantworten konnten, bekamen wir den Auftrag nicht. Das war Realität. Eine, die zunächst schwierig war, die wir aber als Fortschritt empfanden.
Vorauseilender Gehorsam
Es fühlte sich an, als sei der Weg klar: Es ging aufwärts. DEI war nicht mehr „nice to have“, sondern Standard. Und nun? Nun kippt etwas. Mindestens das Vertrauen.
Nach und nach rudern Unternehmen zurück, stellen Maßnahmen ein, verringern Visibilität und Transparenz und versprechen, dass natürlich trotzdem alles „haltungsmäßig“ beim Alten bleibt. Als ob diese Maßnahmen keinen wesentlichen Unterschied gemacht hätten. Auch außerhalb der USA – wo selbstverständlich die Gesetze eingehalten werden müssen – scheinen bei Missachtung der neuen Ansagen der Trump-Regierung wirtschaftliche Nachteile im Raum und Arbeitsplätze auf dem Spiel zu stehen. Ein nicht zu unterschätzender Zielkonflikt.
Worauf es hinausläuft: Ein mitunter vorauseilender Gehorsam trifft uns in Europa. Unternehmen, die fest zu DEI standen, streichen interne Quoten, ordnen DEI-Abteilungen neu, ändern Narrative, passen Reports und Vorstands-Statements an. Sie reagieren auf politischen Druck eines Landes, in dem Anti-Diversity-Strömungen salonfähig geworden sind. Einige schneller, aus Angst, der Wind könnte sich weiter drehen oder weil ihr wirtschaftlicher Erfolg entscheidend vom US-Markt abhängt. Andere schweigen, warten – und hoffen, dass niemand etwas merkt.
Können wir uns das leisten?
Dabei ist das Signal fatal: Wer Haltung einkassiert, sobald sie unbequem wird, hatte nie eine. Wenn das alles nie so wichtig war, warum listeten dann Führungskräfte zu jedem Feiertag der Vielfalt auf Linkedin ihre Errungenschaften auf? Es geht nicht um Symbolpolitik. Es geht um echte Fortschritte – und um die Frage, ob wir es uns leisten können, sie aufs Spiel zu setzen.
Wenn Quoten fallen, wenn Bonusregelungen gestrichen werden, Verantwortlichen für das Thema DEI die Budgets entzogen werden, Vorstandsetagen wieder verstummen, dann wird das Konsequenzen haben. Wir werden verlieren: an inklusiver Teilhabe, vielfältiger Zusammensetzung von Teams, transparenter leistungsorientierter Rekrutierung, Förderung und Beförderung. Es kann auch bedeuten, dass alte Rekrutierungs- und Fördermechanismen wieder greifen – jene, die Jahrzehnte lang für Exklusion gesorgt haben.
Es war ein Versprechen
Die, die nie etwas von Vielfalt hielten, sagen nun: Endlich hört der „Blödsinn“ auf. Aber für uns andere stellt sich weiterhin die Frage: Wie bleiben wir dran und wie weisen wir das nach? Was sagen wir unseren Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden, denen unser Management jahrelang vermittelt hat: Vertraut uns – auch wegen unserer Haltung? Was sagen wir jenen, die uns genau deshalb gewählt haben – als Arbeitgeber, als Marke, als Partner? Was bleibt vom Employer Branding, wenn das, wofür wir angeblich stehen, beim ersten – zugegebenermaßen starken – Gegenwind zurückgenommen wird?
Vertrauen entsteht durch Haltung und durch Beständigkeit. Wer heute laviert, darf sich morgen nicht wundern, wenn Talente sich abwenden und Loyalität erodiert. Denn für viele – intern wie extern – war das nicht „nur ein Programm“. Es war ein Versprechen. Und jetzt schauen alle sehr genau hin, ob wir es halten.
Autorin: Cornelia Kunze ist 1. Vorsitzende von Global Women in Public Relations (GWPR) Deutschland und Inhaberin von I-sekai. Dieser Gast-Beitrag stammt aus dem neuen PR Report.
Exklusive und aktuelle Nachrichten aus der Kommunikationsszene gibt es jeden Mittwoch und Freitag in unserem Newsletter. Kostenlos abonnieren unter http://www.prreport.de/newsletter/
Weitere Themen
11.04.2023
14.06.2024
20.12.2023
07.08.2024
02.06.2023