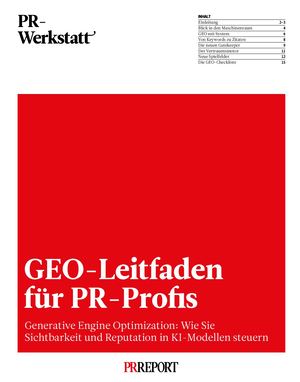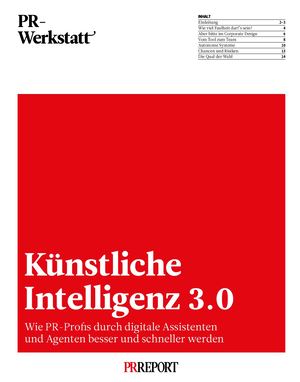News / KI in der PR: Kennzeichnen oder nicht?
29.04.2024
Wissen & Praxis
KI in der PR: Kennzeichnen oder nicht?
Die Positionen in der PR-Branche zu dieser Frage reichen von „bitte rigoros“ bis „nicht nötig“. Die DRPR-Vorsitzende Elke Kronewald bezeichnet die Richtlinie der Ethikwächter als „Mindestmaß“.
Die Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist rasend schnell. Aber wie viel KI-Einsatz in der PR ist legitim? Und zu welchen Zwecken?
Sind 20 Prozent KI-Anteil bei einem Text in Ordnung? 50 Prozent? Mehr? Mit oder ohne Endabnahme durch einen Menschen? Sind KI-erstellte Videos okay, sobald sie als solche gekennzeichnet sind? Wie muss gekennzeichnet werden?
„Es wäre fatal, wenn wir die Vorteile dieser Technologie nicht nutzen würden", sagt die Beraterin Petra Sammer, früher bei Ketchum als Geschäftsführerin und Chief Creative Officer tätig. „Ich würde mir allerdings eine viel rigorosere Kennzeichnungspflicht wünschen – als verpflichtenden Standard unserer Branche, ohne zu lange auf die Gesetzgebung zu warten.“
Ihre Idee: „Warum nicht einen Abbinder unter jeder Pressemitteilung einfügen, in dem kurz angegeben wird, welche KI-Apps zur Anwendung gekommen sind? Noch viel wichtiger ist das bei Bild- und Bewegtbildkommunikation.“
Michael Bürker, Professor für Marketing, Kommunikation und Marktforschung, schlägt vor, „dass Unternehmen in Texten oder Fotos auf ihrer Website, in den Geschäftsbedingungen oder in Verträgen offenlegen, wann sie mit KI arbeiten und wie sie das machen. Umgekehrt könnte man auch explizit erwähnen, wenn man auf KI verzichtet.“
„Kennzeichnung nicht zwingend notwendig“
Die Selbstkontrollorgane der Kommunikationsbranche haben erste Leitplanken errichtet. Der österreichische PR-Ethikrat hat im Sommer 2023 einen Leitfaden zu generativer KI veröffentlicht. „Zumindest sollte angegeben werden, dass generative KI zur Text- und/oder Bilderstellung verwendet wurde“, sagt dessen Vorsitzende Uta Rußmann. „Noch besser wäre es, wenn angegeben wird, welche generative KI verwendet wurde und zu welchem Prozentsatz.“
In der Richtlinie des Deutschen Rats für Public Relations (DRPR) heißt es: Eine Kennzeichnung sei immer dann verpflichtend, wenn „KI-generierter Content ungeprüft erstellt und veröffentlicht wird (z. B. KI-basierte Übersetzung von Content)“. Oder wenn bei Rezipienten der Eindruck entstehen könne, dass es sich „um die Wiedergabe bzw. Abbildung von Realität handelt (z. B. KI-generierte Bilder, auch wenn diese manuell nachbearbeitet wurden)“.
Der DRPR legt nicht fest, ab welchem Anteil und wie der Einsatz von KI gekennzeichnet werden muss. „Da KI-generierte Inhalte in ihren Erscheinungsformen sehr unterschiedlich sind, kann auch die eindeutige Kennzeichnung unterschiedliche Formen annehmen“, sagt die DRPR-Vorsitzende Elke Kronewald.
Diese müsse auch für Laien verständlich sein. „Die Kennzeichnung muss bei der Rezeption des KI-generierten Inhalts direkt mit-rezipiert werden können“, erklärt sie, und dürfe „nicht irgendwo versteckt sein oder durch kryptische Formulierungen verschleiert werden, um Irreführung zu vermeiden.“
Der DRPR habe ein „Mindestmaß“ formuliert, sagt Kronewald: „Sobald ein Mensch einen KI-generierten Text auf Richtigkeit sowie Wahrhaftigkeit geprüft und freigegeben hat, ist eine Kennzeichnung aus Sicht des Rats nicht zwingend notwendig.“
Bei Bildern sollte man hingegen vorsichtiger sein. „Bild- und Video-KIs entwickeln sich rasend schnell und die Ergebnisse sehen täuschend echt aus. Deshalb sollte hier auf jeden Fall gekennzeichnet werden, dass es sich um KI-generierte Inhalte handelt.“ Maximale Transparenz und deutliche Kennzeichnung könnten derzeit sogar ein USP für Agenturen oder Kommunikationsabteilungen sein.
Der Mensch als finale Instanz
„Die Prüfpflicht betrifft aus Sicht des DRPR insbesondere die Aspekte Richtigkeit und Wahrhaftigkeit“, sagt Kronewald weiter. In der Praxis kämen Aspekte wie Plagiatsprüfungen, Übereinstimmung mit dem Corporate Wording oder den Kernbotschaften hinzu.
„Ungeprüft“ bedeutet laut Kronewald, „dass KI-generierter Content nicht auf Richtigkeit und Wahrhaftigkeit kontrolliert wurde. Insbesondere bei Medienplattformen, in denen zur Generierung von Durchsatz und Reichweite massiv auf KI-Unterstützung gesetzt wird, sorgt dies bereits heute für sachlich-faktische Ungenauigkeiten.“ Ein Fallbeispiel aus der PR wäre laut Kronewald eine KI-basierte Simultan-Übersetzung ohne Möglichkeit, diese zu prüfen.
„Die Autorisierung durch Menschen ist Pflicht“, findet Bürker. Er verweist aber auf die natürlichen Grenzen von Freigabeprozessen, wie eben beim Simultan-Dolmetschen einer Rede durch KI. Ein solches Risiko sollten Unternehmen nur eingehen, wenn sie auf die Nutzung von KI hinweisen, findet er. Besonders in der Finanzkommunikation könne eine ungeprüfte Übersetzung mit Fehlern gravierende Folgen haben, erst recht, wenn es um börsenrelevante Aussagen gehe.
„Für das Publikum ist nicht entscheidend, wie die Inhalte entstehen“
Sascha Stoltenow, Partner bei der Agentur Script Communications, hält indes nichts von einer Kennzeichnungspflicht: „Man würde auch nicht darunterschreiben ,Ich habe für meinen Text gegoogelt und Word genutzt‘.“ Bei Script seien alle Prompts in einer Datenbank gespeichert, inklusive Ausgangsfrage, Anweisung und Endfrage. Der Einsatz von KI erfolge in Absprache mit den Kunden. Diese könnten alle Prozessschritte bei Bedarf jederzeit einsehen.
Die Urheberschaft für KI-Inhalte liege immer bei der Person oder der Firma, die den Computer bedient oder den Prompt geschrieben hat. Stoltenow: „Vor allem im Kundenservice und im Marketing, wo bereits heute viele Prozesse automatisiert sind, wird KI zunehmend eingesetzt werden. Das entbindet die Unternehmen aber nicht von ihrer Verantwortung für die Inhalte. Für das Publikum ist nicht entscheidend, wie die Inhalte entstehen, sondern dass das Unternehmen deren Richtigkeit garantiert.“ Dieser Punkt komme aus seiner Sicht bei allen Diskussionen um Recht und Ethik von KI momentan zu kurz.
Beim Einsatz von KI obliege Kommunikationsprofis die „menschliche Letztentscheidung“, zitiert die DRPR-Richtlinie den Deutschen Ethikrat. Heißt: Menschen sollten darüber entscheiden, welche KI sie wann und wofür einsetzen, wie sie mit KI-generierten Inhalten und Ergebnissen umgehen und welche formalen und inhaltlichen Prüfungen sie durchführen, sagt Kronewald.
Autor: Marcus Schuster
Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus unserem großen KI-Special in der aktuellen Ausgabe des PR Reports. Lesen Sie darin:
„Technologie-Kompetenz wird überlebenswichtig“
Christoph Bornschein und Max Orgeldinger von TLGG sagen, wie Agenturen und Unternehmen fit für das KI-Zeitalter werden.
PR-Profis verraten ihre Lieblings-Prompts
Ob kurzer Befehl oder ausführliche Anweisungsketten: Welche Eingaben zu Top-Ergebnissen führen.
KI im Newsroom
Welche Lösungen die Sparkassen-Gruppe einsetzt und was sie bringen.
Stimmen aus der Maschine
KI-Anwendungen in der Podcast-Produktion versprechen schnellere und billigere Prozesse. Wie Redaktionen und Medienmacher die Tools nutzen und welche Erfahrungen sie damit machen.
Wie viel KI-Einsatz in der PR ist legitim? Und zu welchen Zwecken?
Was Ethikräte und Experten fordern.
Verstärkung für die deutsche KI-Hoffnung
Was sich Jan Hiesserich bei Aleph Alpha vorgenommen hat.
Sind 20 Prozent KI-Anteil bei einem Text in Ordnung? 50 Prozent? Mehr? Mit oder ohne Endabnahme durch einen Menschen? Sind KI-erstellte Videos okay, sobald sie als solche gekennzeichnet sind? Wie muss gekennzeichnet werden?
„Es wäre fatal, wenn wir die Vorteile dieser Technologie nicht nutzen würden", sagt die Beraterin Petra Sammer, früher bei Ketchum als Geschäftsführerin und Chief Creative Officer tätig. „Ich würde mir allerdings eine viel rigorosere Kennzeichnungspflicht wünschen – als verpflichtenden Standard unserer Branche, ohne zu lange auf die Gesetzgebung zu warten.“
Ihre Idee: „Warum nicht einen Abbinder unter jeder Pressemitteilung einfügen, in dem kurz angegeben wird, welche KI-Apps zur Anwendung gekommen sind? Noch viel wichtiger ist das bei Bild- und Bewegtbildkommunikation.“
Michael Bürker, Professor für Marketing, Kommunikation und Marktforschung, schlägt vor, „dass Unternehmen in Texten oder Fotos auf ihrer Website, in den Geschäftsbedingungen oder in Verträgen offenlegen, wann sie mit KI arbeiten und wie sie das machen. Umgekehrt könnte man auch explizit erwähnen, wenn man auf KI verzichtet.“
„Kennzeichnung nicht zwingend notwendig“
Die Selbstkontrollorgane der Kommunikationsbranche haben erste Leitplanken errichtet. Der österreichische PR-Ethikrat hat im Sommer 2023 einen Leitfaden zu generativer KI veröffentlicht. „Zumindest sollte angegeben werden, dass generative KI zur Text- und/oder Bilderstellung verwendet wurde“, sagt dessen Vorsitzende Uta Rußmann. „Noch besser wäre es, wenn angegeben wird, welche generative KI verwendet wurde und zu welchem Prozentsatz.“
In der Richtlinie des Deutschen Rats für Public Relations (DRPR) heißt es: Eine Kennzeichnung sei immer dann verpflichtend, wenn „KI-generierter Content ungeprüft erstellt und veröffentlicht wird (z. B. KI-basierte Übersetzung von Content)“. Oder wenn bei Rezipienten der Eindruck entstehen könne, dass es sich „um die Wiedergabe bzw. Abbildung von Realität handelt (z. B. KI-generierte Bilder, auch wenn diese manuell nachbearbeitet wurden)“.
Der DRPR legt nicht fest, ab welchem Anteil und wie der Einsatz von KI gekennzeichnet werden muss. „Da KI-generierte Inhalte in ihren Erscheinungsformen sehr unterschiedlich sind, kann auch die eindeutige Kennzeichnung unterschiedliche Formen annehmen“, sagt die DRPR-Vorsitzende Elke Kronewald.
Diese müsse auch für Laien verständlich sein. „Die Kennzeichnung muss bei der Rezeption des KI-generierten Inhalts direkt mit-rezipiert werden können“, erklärt sie, und dürfe „nicht irgendwo versteckt sein oder durch kryptische Formulierungen verschleiert werden, um Irreführung zu vermeiden.“
Der DRPR habe ein „Mindestmaß“ formuliert, sagt Kronewald: „Sobald ein Mensch einen KI-generierten Text auf Richtigkeit sowie Wahrhaftigkeit geprüft und freigegeben hat, ist eine Kennzeichnung aus Sicht des Rats nicht zwingend notwendig.“
Bei Bildern sollte man hingegen vorsichtiger sein. „Bild- und Video-KIs entwickeln sich rasend schnell und die Ergebnisse sehen täuschend echt aus. Deshalb sollte hier auf jeden Fall gekennzeichnet werden, dass es sich um KI-generierte Inhalte handelt.“ Maximale Transparenz und deutliche Kennzeichnung könnten derzeit sogar ein USP für Agenturen oder Kommunikationsabteilungen sein.
Der Mensch als finale Instanz
„Die Prüfpflicht betrifft aus Sicht des DRPR insbesondere die Aspekte Richtigkeit und Wahrhaftigkeit“, sagt Kronewald weiter. In der Praxis kämen Aspekte wie Plagiatsprüfungen, Übereinstimmung mit dem Corporate Wording oder den Kernbotschaften hinzu.
„Ungeprüft“ bedeutet laut Kronewald, „dass KI-generierter Content nicht auf Richtigkeit und Wahrhaftigkeit kontrolliert wurde. Insbesondere bei Medienplattformen, in denen zur Generierung von Durchsatz und Reichweite massiv auf KI-Unterstützung gesetzt wird, sorgt dies bereits heute für sachlich-faktische Ungenauigkeiten.“ Ein Fallbeispiel aus der PR wäre laut Kronewald eine KI-basierte Simultan-Übersetzung ohne Möglichkeit, diese zu prüfen.
„Die Autorisierung durch Menschen ist Pflicht“, findet Bürker. Er verweist aber auf die natürlichen Grenzen von Freigabeprozessen, wie eben beim Simultan-Dolmetschen einer Rede durch KI. Ein solches Risiko sollten Unternehmen nur eingehen, wenn sie auf die Nutzung von KI hinweisen, findet er. Besonders in der Finanzkommunikation könne eine ungeprüfte Übersetzung mit Fehlern gravierende Folgen haben, erst recht, wenn es um börsenrelevante Aussagen gehe.
„Für das Publikum ist nicht entscheidend, wie die Inhalte entstehen“
Sascha Stoltenow, Partner bei der Agentur Script Communications, hält indes nichts von einer Kennzeichnungspflicht: „Man würde auch nicht darunterschreiben ,Ich habe für meinen Text gegoogelt und Word genutzt‘.“ Bei Script seien alle Prompts in einer Datenbank gespeichert, inklusive Ausgangsfrage, Anweisung und Endfrage. Der Einsatz von KI erfolge in Absprache mit den Kunden. Diese könnten alle Prozessschritte bei Bedarf jederzeit einsehen.
Die Urheberschaft für KI-Inhalte liege immer bei der Person oder der Firma, die den Computer bedient oder den Prompt geschrieben hat. Stoltenow: „Vor allem im Kundenservice und im Marketing, wo bereits heute viele Prozesse automatisiert sind, wird KI zunehmend eingesetzt werden. Das entbindet die Unternehmen aber nicht von ihrer Verantwortung für die Inhalte. Für das Publikum ist nicht entscheidend, wie die Inhalte entstehen, sondern dass das Unternehmen deren Richtigkeit garantiert.“ Dieser Punkt komme aus seiner Sicht bei allen Diskussionen um Recht und Ethik von KI momentan zu kurz.
Beim Einsatz von KI obliege Kommunikationsprofis die „menschliche Letztentscheidung“, zitiert die DRPR-Richtlinie den Deutschen Ethikrat. Heißt: Menschen sollten darüber entscheiden, welche KI sie wann und wofür einsetzen, wie sie mit KI-generierten Inhalten und Ergebnissen umgehen und welche formalen und inhaltlichen Prüfungen sie durchführen, sagt Kronewald.
Autor: Marcus Schuster
Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus unserem großen KI-Special in der aktuellen Ausgabe des PR Reports. Lesen Sie darin:
„Technologie-Kompetenz wird überlebenswichtig“
Christoph Bornschein und Max Orgeldinger von TLGG sagen, wie Agenturen und Unternehmen fit für das KI-Zeitalter werden.
PR-Profis verraten ihre Lieblings-Prompts
Ob kurzer Befehl oder ausführliche Anweisungsketten: Welche Eingaben zu Top-Ergebnissen führen.
KI im Newsroom
Welche Lösungen die Sparkassen-Gruppe einsetzt und was sie bringen.
Stimmen aus der Maschine
KI-Anwendungen in der Podcast-Produktion versprechen schnellere und billigere Prozesse. Wie Redaktionen und Medienmacher die Tools nutzen und welche Erfahrungen sie damit machen.
Wie viel KI-Einsatz in der PR ist legitim? Und zu welchen Zwecken?
Was Ethikräte und Experten fordern.
Verstärkung für die deutsche KI-Hoffnung
Was sich Jan Hiesserich bei Aleph Alpha vorgenommen hat.
Weitere Themen
29.01.2026
04.02.2026
06.02.2026
05.12.2025
24.06.2025